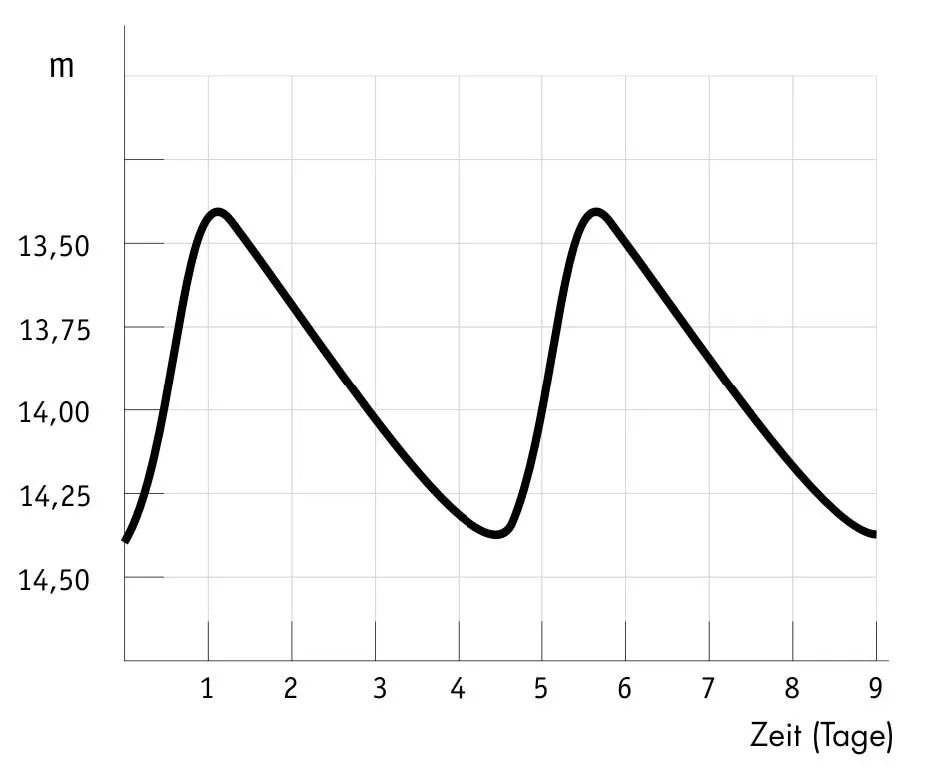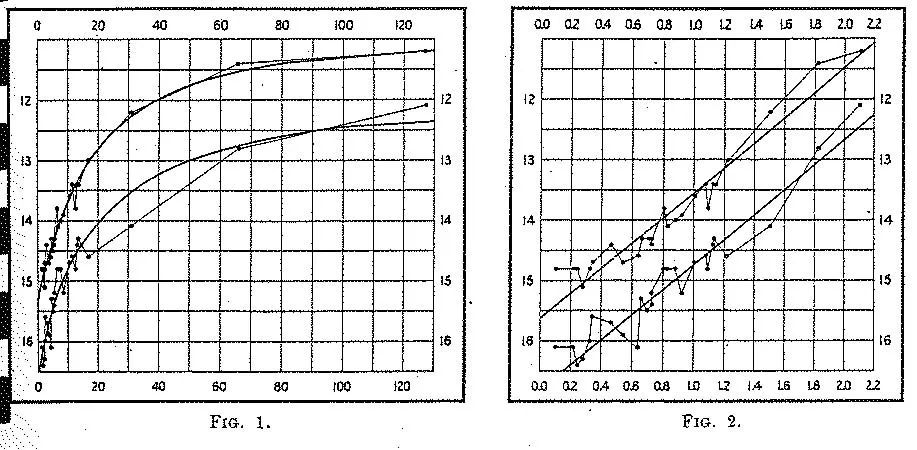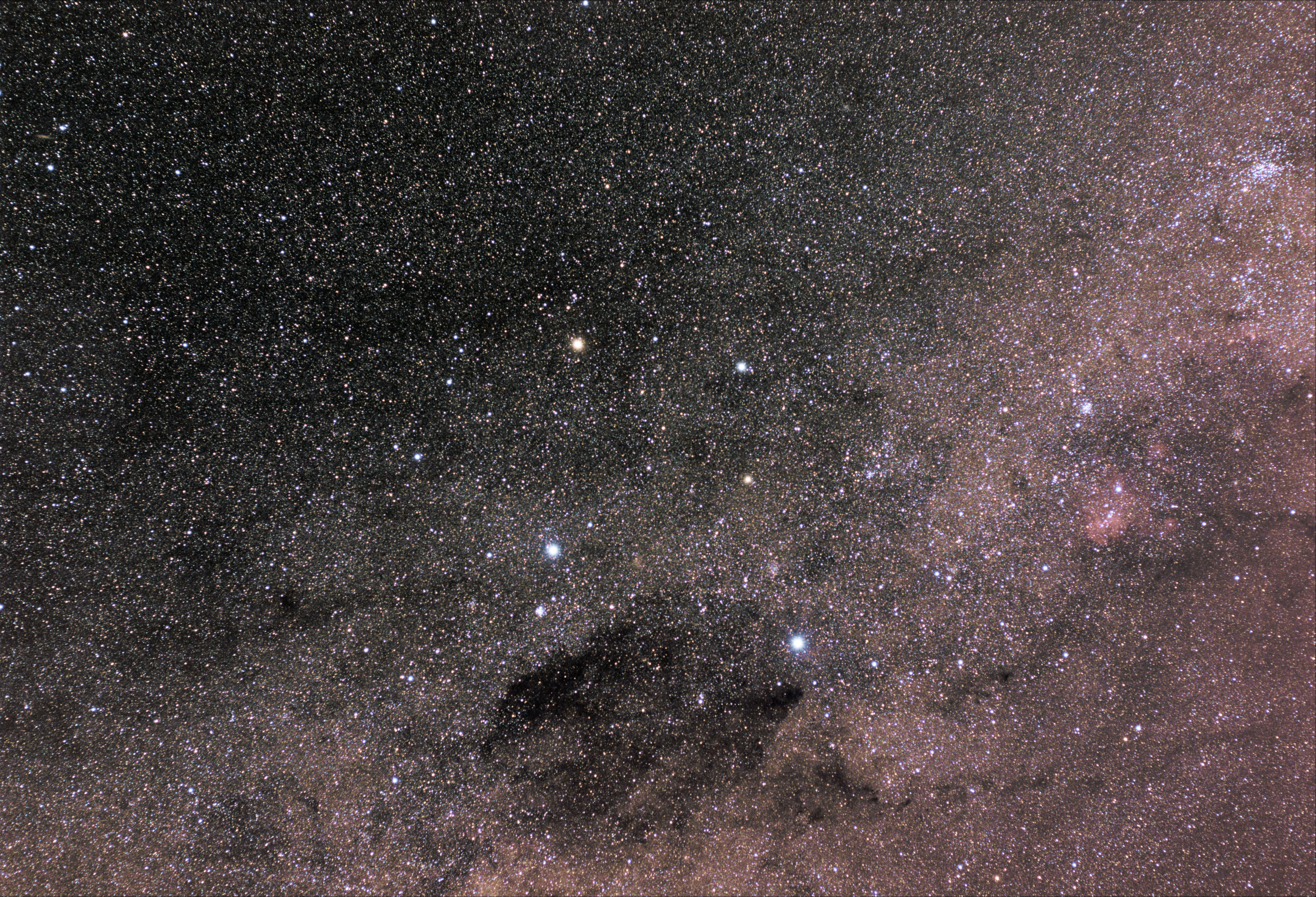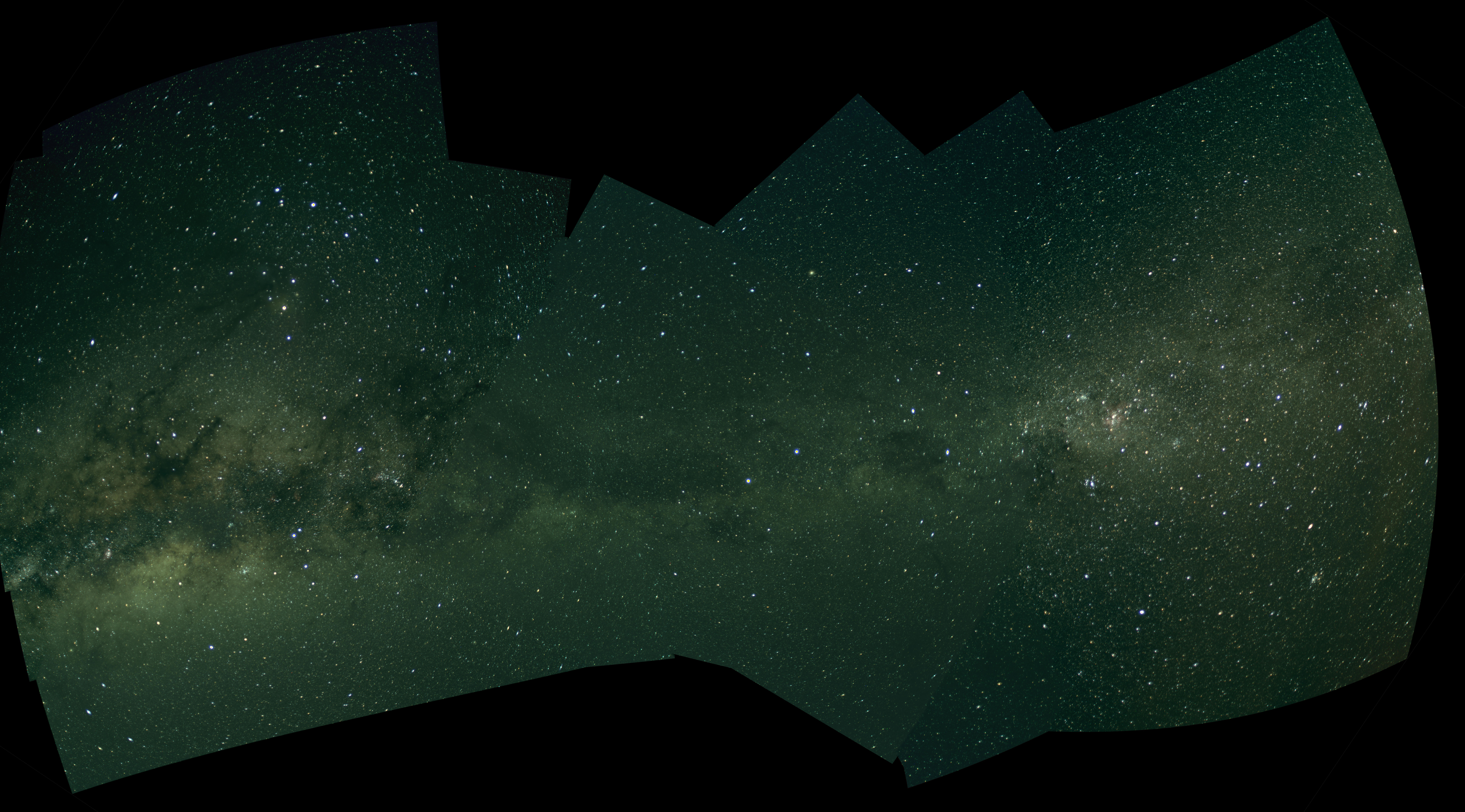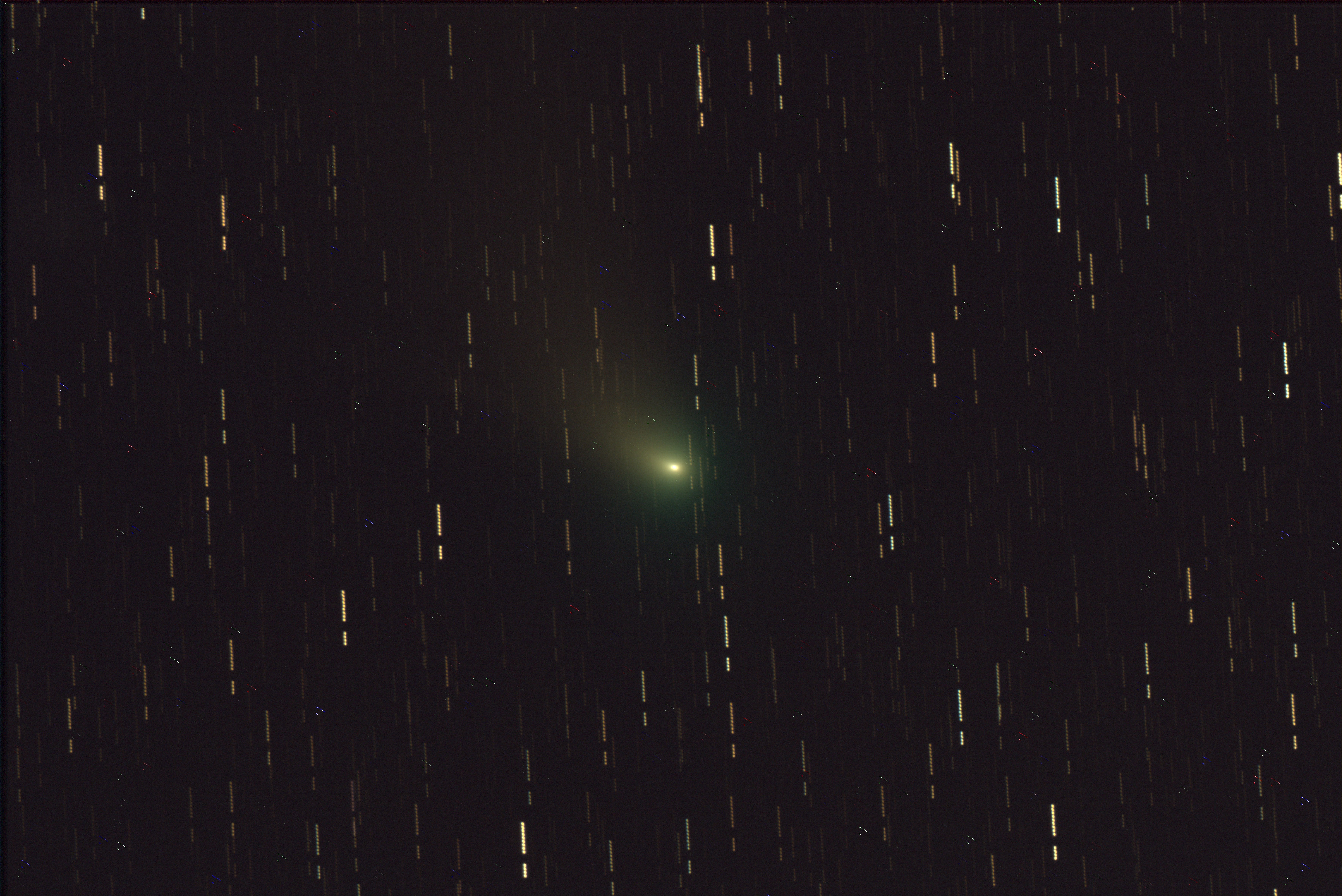Gehört zu: Beobachtungsobjekte
Siehe auch: Sternhaufen
Benutzt: Fotos aus Google Archiv
Stand: 31.05.2023
Link: https://people.smp.uq.edu.au/HolgerBaumgardt/globular/
Kugelsternhaufen
Der Klassiker: M13 im Herkules
- M13 = NGC6205
- Anzahl Sterne: 500.000
- Entfernung: 25.000 Lichtjahre
- Alter: 11,6 – 12,6 Milliarden Jahre
Auch im Herkules: M92
- M92 = NGC 6341
- Gesamtmasse: 330.000 Sonnenmassen
- Entfernung: ca. 26.000 Lichtjahre
- Alter: ca. 13 Milliarden Jahre
Was ist ein Kugelsternhaufen?
- Kugelsternhaufen gehören zu den Deep Sky Objekten
- Sie sind kugelsymmetrisch
- Anzahl Sterne: typischerweise mehrere 100.000
- Die Sterne gravitativ an einander gebunden
- Der Haufen ist gravitativ an eine Galaxis gebunden – die meisten Bahnen verlaufen ausserhalb der galaktischen Scheibe
Kugelsternhaufen in unserer Galaxis
- ca. 168 Kugelsternhaufen in unserer Milchstrasse
- Diese Kugelstenhaufen befinden sich in einem kugelförmichen Halo um die Milchstrasse herum
Alter von Kugelsternhaufen
- So alt wie die Milchstrasse (Population II, fast keine Metalle)
- Abknickpunkt im Hertzsprung-Russel-Diagramm
Kugelsternhaufen in der Andromeda-Galaxis (M31)
Im Halo der Andromeda-Galaxis gubt es ca. 500 Kugelsternhaufen.
Schöne Kugelsternhaufen (in unserer Galaxis)
Meine Kriterien: Größer als 10′ und heller als 8,0 mag
| Lfd.Nr. | Kurzbezeichnung | Ausdehnung | Helligkeit | Sternbild | Bemerkungen | Status | |
| Omega Cen | 55′ | 5,3 mag | Zentauer | Namibia (NGC 5139) | |||
| 47 Tuc | 31′ | 4,9 mag | Tukan | Namibia (NGC 104) | |||
| M2 | 16′ | 6,3 mag | Wassermann | Dekl=0°, sichtbar Sep, Okt, Nov (NGC 7089) | |||
| M3 | 18′ | 6,3 mag | Jagdhunde | im Frühjahr sichtbar (NGC 5272) | |||
| M4 | 36′ | 5,9 mag | Skorpion | Dekl=-26°, bei Antares, sichtbar Mai= am Morgenhimmel, Juni= ab Mitternacht (NGC 6121) |
|||
| M5 | 23′ | 5,6 mag | Serpens | Dekl=+2°, Beobachtung: April-September (NGC 5904) |
|||
| M10 | 20′ | 6,6 mag | Oph | Zweithellster KH im Oph (NGC 6254) | |||
| M12 | 16′ | 6,1 mag | Oph | Der hellste Kugelhaufen im Oph (NGC 6218) | |||
| M13 | 20′ | 5,8 mag | Herkules | Abendhimmel: Apr, Mai, Juni (NGC 6205) | |||
| M15 | 18′ | 6,2 mag | Peg | (NGC 7078) | |||
| M22 | 32′ | 5,5 mag | Sgr | Hellster Kugelsternhaufen, der von Hamburg aus beobachtbar ist – allerdings tief am Südhimmel (NGC 6656) | |||
| M30 | 12′ | 7,7 mag | Capricornus | Dunkel, Dekl= -23°, Aug – Okt (NCC 7099) | |||
| M80 | 10′ | 8,7 mag | Skorpion | Dekl=-23° (NGC 6093) | |||
| M92 | 14′ | 6,3 mag | Herkules | Abendhimmel: Apr, Mai, Juni (NGC 6341) | |||
Helle Nebel und Galaxien im Messier-Katalog
Quelle: VdS “Astronomie – Ihr neues Hobby”
| Nr. | Name | Sternbild | Beobachtungszeit |
| M 1 | Krebsnebel (SN) | Stier | Nov, Dez |
| M 27 | Hantelnabel (PN) | Fuchs | Juni, Juli |
| M 81 | Bodes Galaxie | Großer Bär | Jan-Dez |
| M 82 | Zigarren Galaxie | Großer Bär | Jan-Dez |
| M 94 | Katzenauge-Galaxis | Jagdhunde | Feb, Mrz,… |
| M 101 | Pinwheel-Galaxis | Großer Bär | Mrz, Apr,… |
Asterismen
Bis Feb. 2024 noch nicht beobachteter Asterismus:
| The broken engagement ring | SAO 27788 | Rechts von Merak (Beta UMa Kasten rechts unten) |